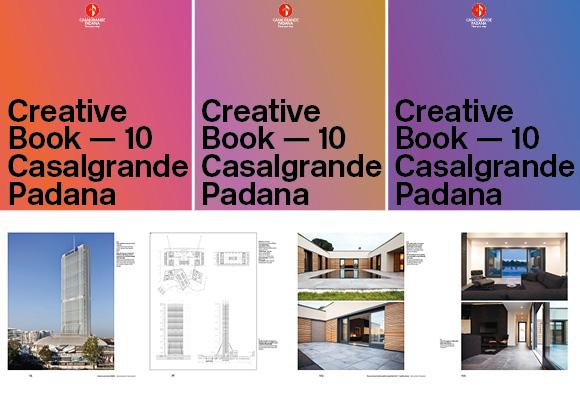Bleiben Sie immer aktuell informiert über die Welt der Architektur und des Desig
Empfohlene Artikel
Zum Newsletter anmelden
Wenn Sie auf „Anmelden" klicken, akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen
Telefon: +39 0522 9901
E-Mail: info@casalgrandepadana.it
Via Statale 467, 73 – 42013 Casalgrande (RE) – Italien – Tel. +39 0522 9901 – Fax. +39 0522 996121 – USt-IdNr. IT01270230350 Steuernummer: 01622500369 Eingetragen im Handelsregister von RE: 178600 Gesellschaftskapital, v.e.: 29.816.600,00 Euro